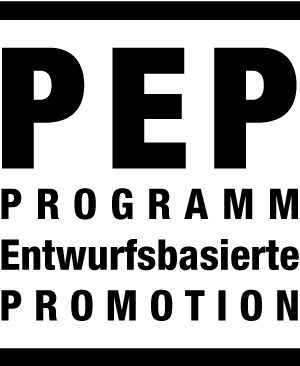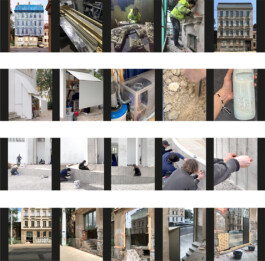
Die bauende Architekt*in
Florian Summa
Vor rund 600 Jahren waren Planen und Bauen für Leon Battista Alberti zwei ziemlich verschiedene Paar Schuhe, die streng voneinander zu trennen seien: Hier der geistige Entwurf - die intellektuell-schöpferische Leistung der Architekt*in -, dort die praktische Ausführung auf der Baustelle – als notwendiger Akt, der das geistige Konstrukt jedoch eher ungünstig verfälscht als verbessert. Dieses neuzeitliche Konzept der „Lineamente“ prägt vor dem Hintergrund eines mittlerweile stark regulierten und industrialisierten Baugeschehens in veränderter Form auch den heutigen Architekturproduktionsprozess. Ihm voraus ging in vorneuzeitlicher Zeit ein weitaus unhierarchischeres Modell, bei dem viele Entwurfsentscheidungen direkt auf der Baustelle von erfahrenen Handwerker*innen in der Rolle von Baumeister*innen getroffen wurden.
Neben diesen beiden Phänomenen – scharfer Trennung zwischen geistigem Entwurf und materieller Ausführung einerseits und Verschmelzung durch gleichzeitig entwerfende und bauende Handwerker*innen andererseits – ist eine dritte Konstellation vorstellbar: die bauende Architekt*in. Diese Figur pendelt ähnlich wie die Baumeister*in zwischen den beiden Welten, jedoch mit ihren Wurzeln nicht im Handwerk, sondern in der Architekturprofession. Sie ist zu ungeduldig, auf den physisch-praktischen Bauakt durch Dritte zu warten: Ihr fehlen wechselweise die Anlässe, die Auftraggeber*innen, die Gutheißungen, die Genehmigungen, die Handwerker*innen, das Budget – oder vieles von all dem gleichzeitig. Und sie erkennt: Bauen und Entwerfen im Bestand funktioniert mit Albertis strikter Trennung zwischen Planen und Bauen nicht besonders gut. Die „bauende Architekt*in“ kann gar nicht entwerfen, ohne zu bauen.
Ad-hoc und zu den unpassendsten Zeitpunkten beginnt sie ihre Gedanken selber zu materialisieren: Nicht als Modell, denn das wären nur weitere Abstraktionen und Umkreisungen. Nein, sie baut „wirkliche“ Fenster, Türen, Mauerwände - und webt diese Artefakte als benutzbare Konstruktionen direkt in die gebaute Realität ein. Sie stellt fest, dass diese „gebauten Skizzen“ einer sonderbaren Zwischensphäre zugehörig sind – nicht mehr Modell, aber auch noch nicht ganz der komplexen Wirklichkeit zugehörig.
Die Forschungsarbeit thematisiert die Frage, welche Möglichkeiten sich aus solchen „gebauten Skizzen“ für die professionalisierte Architektur- und Baupraxis ergeben. Es wird angenommen, dass sie als Werkzeuge gleichermaßen Zwecke der Befreiung, des Ermöglichens, des Verständigens, des Überschreitens, des Beschleunigens und Verzögerns oder auch des Lernens innerhalb des Entwurfs- und Bauprozesses erfüllen können. In einem systematisierten Ordnungsprozess sollen diese unterschiedlichen Dimensionen herausgearbeitet werden – und gleichzeitig anhand weiterer Bauakte unmittelbar überprüft werden.
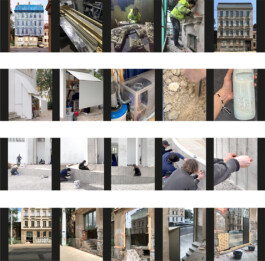
Die bauende Architekt*in
Florian Summa
Vor rund 600 Jahren waren Planen und Bauen für Leon Battista Alberti zwei ziemlich verschiedene Paar Schuhe, die streng voneinander zu trennen seien: Hier der geistige Entwurf - die intellektuell-schöpferische Leistung der Architekt*in -, dort die praktische Ausführung auf der Baustelle – als notwendiger Akt, der das geistige Konstrukt jedoch eher ungünstig verfälscht als verbessert. Dieses neuzeitliche Konzept der „Lineamente“ prägt vor dem Hintergrund eines mittlerweile stark regulierten und industrialisierten Baugeschehens in veränderter Form auch den heutigen Architekturproduktionsprozess. Ihm voraus ging in vorneuzeitlicher Zeit ein weitaus unhierarchischeres Modell, bei dem viele Entwurfsentscheidungen direkt auf der Baustelle von erfahrenen Handwerker*innen in der Rolle von Baumeister*innen getroffen wurden.
Neben diesen beiden Phänomenen – scharfer Trennung zwischen geistigem Entwurf und materieller Ausführung einerseits und Verschmelzung durch gleichzeitig entwerfende und bauende Handwerker*innen andererseits – ist eine dritte Konstellation vorstellbar: die bauende Architekt*in. Diese Figur pendelt ähnlich wie die Baumeister*in zwischen den beiden Welten, jedoch mit ihren Wurzeln nicht im Handwerk, sondern in der Architekturprofession. Sie ist zu ungeduldig, auf den physisch-praktischen Bauakt durch Dritte zu warten: Ihr fehlen wechselweise die Anlässe, die Auftraggeber*innen, die Gutheißungen, die Genehmigungen, die Handwerker*innen, das Budget – oder vieles von all dem gleichzeitig. Und sie erkennt: Bauen und Entwerfen im Bestand funktioniert mit Albertis strikter Trennung zwischen Planen und Bauen nicht besonders gut. Die „bauende Architekt*in“ kann gar nicht entwerfen, ohne zu bauen.
Ad-hoc und zu den unpassendsten Zeitpunkten beginnt sie ihre Gedanken selber zu materialisieren: Nicht als Modell, denn das wären nur weitere Abstraktionen und Umkreisungen. Nein, sie baut „wirkliche“ Fenster, Türen, Mauerwände - und webt diese Artefakte als benutzbare Konstruktionen direkt in die gebaute Realität ein. Sie stellt fest, dass diese „gebauten Skizzen“ einer sonderbaren Zwischensphäre zugehörig sind – nicht mehr Modell, aber auch noch nicht ganz der komplexen Wirklichkeit zugehörig.
Die Forschungsarbeit thematisiert die Frage, welche Möglichkeiten sich aus solchen „gebauten Skizzen“ für die professionalisierte Architektur- und Baupraxis ergeben. Es wird angenommen, dass sie als Werkzeuge gleichermaßen Zwecke der Befreiung, des Ermöglichens, des Verständigens, des Überschreitens, des Beschleunigens und Verzögerns oder auch des Lernens innerhalb des Entwurfs- und Bauprozesses erfüllen können. In einem systematisierten Ordnungsprozess sollen diese unterschiedlichen Dimensionen herausgearbeitet werden – und gleichzeitig anhand weiterer Bauakte unmittelbar überprüft werden.