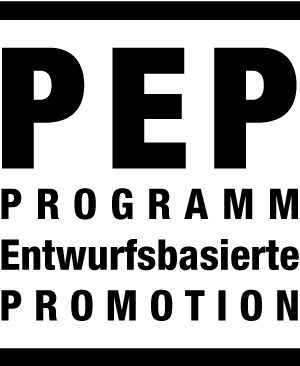Die vorliegende Forschungsarbeit zeigt drei gebaute Projekte, die eins gemeinsam haben: Die Entstehung in interkultureller Kollaboration mit der Verknüpfung von universitär erlernten Theorien in Deutschland und ortsangemessenen, kulturbedingten Praktiken aus Simbabwe. Es geht um den Bau einer Grundschule, eines Brunnens und eines Veranstaltungspavillons in Harare, Simbabwe. Alle Projekte werden in deutschem Kontext geplant und in simbabwischem Umfeld gebaut. Langjährige Planungs- und Bauzeiten ermöglichen einen tiefen Einblick in die Einflussnahme von in Simbabwe ortstypischen Elementen in die Gestaltung der Architektur. Durch Anpassungen von Details während der Bauphasen haben traditionelle, simbabwische Elemente, die kulturell verankert sind, einen Weg in die Ausführung der Projekte gefunden. Ziel der Forschungsarbeit ist es, diesen Einfluss herauszuarbeiten und zu explizieren.
Mit der theoretischen Kontextualisierung wird das Forschungsthema in Bezug auf die Begriffe der Kultur und Tradition definiert. Die baupraktische Kontextualisierung zeigt auf, wie andere Architekturschaffende mit vergleichbaren Entwurfs- und Bauprojekten im interkulturellen Zusammenhang mit dem Kulturbegriff umgehen.
Die Kontextualisierungen führen zum entwurfsbasierten Teil der Forschungsarbeit. Dieser bildet mit der Entwurfsforschung (Design Research) den Katalog der Verflech-tungen, der zum einen die Projekthistorien herausarbeitet - als zeichnerische Gegen-überstellung von ortsüblichen, geplanten und umgesetzten Bauweisen. Zum anderen werden die Ergebnisse des Herauszeichnens auf ein neues Anwendungsobjekt im forschenden Entwerfen (Research-by-Design) übertragen. Es wird ein Entwurf für ein Ausstellungsgebäude im Umkreis von Harare erarbeitet.
Das Ergebnis ist ein Entwurf, der sich stark mit den vor Ort vorgefundenen Einflüssen, die auf kulturbedingte Gewohnheiten zurückzuführen sind, beschäftigt. Diese werden durch eine intensive Beschäftigung während eines Aufenthalts am Standort sichtbar und durch die aufgestellten, kulturbedingten Entwurfsparameter in den Entwurfsprozess übertragen. Die Übertragung bildet den Abschluss des hier vorgestellten kulturbasierten Entwerfens im Rahmen der entwurfsbasierten Forschung.

Die vorliegende Forschungsarbeit zeigt drei gebaute Projekte, die eins gemeinsam haben: Die Entstehung in interkultureller Kollaboration mit der Verknüpfung von universitär erlernten Theorien in Deutschland und ortsangemessenen, kulturbedingten Praktiken aus Simbabwe. Es geht um den Bau einer Grundschule, eines Brunnens und eines Veranstaltungspavillons in Harare, Simbabwe. Alle Projekte werden in deutschem Kontext geplant und in simbabwischem Umfeld gebaut. Langjährige Planungs- und Bauzeiten ermöglichen einen tiefen Einblick in die Einflussnahme von in Simbabwe ortstypischen Elementen in die Gestaltung der Architektur. Durch Anpassungen von Details während der Bauphasen haben traditionelle, simbabwische Elemente, die kulturell verankert sind, einen Weg in die Ausführung der Projekte gefunden. Ziel der Forschungsarbeit ist es, diesen Einfluss herauszuarbeiten und zu explizieren.
Mit der theoretischen Kontextualisierung wird das Forschungsthema in Bezug auf die Begriffe der Kultur und Tradition definiert. Die baupraktische Kontextualisierung zeigt auf, wie andere Architekturschaffende mit vergleichbaren Entwurfs- und Bauprojekten im interkulturellen Zusammenhang mit dem Kulturbegriff umgehen.
Die Kontextualisierungen führen zum entwurfsbasierten Teil der Forschungsarbeit. Dieser bildet mit der Entwurfsforschung (Design Research) den Katalog der Verflech-tungen, der zum einen die Projekthistorien herausarbeitet - als zeichnerische Gegen-überstellung von ortsüblichen, geplanten und umgesetzten Bauweisen. Zum anderen werden die Ergebnisse des Herauszeichnens auf ein neues Anwendungsobjekt im forschenden Entwerfen (Research-by-Design) übertragen. Es wird ein Entwurf für ein Ausstellungsgebäude im Umkreis von Harare erarbeitet.
Das Ergebnis ist ein Entwurf, der sich stark mit den vor Ort vorgefundenen Einflüssen, die auf kulturbedingte Gewohnheiten zurückzuführen sind, beschäftigt. Diese werden durch eine intensive Beschäftigung während eines Aufenthalts am Standort sichtbar und durch die aufgestellten, kulturbedingten Entwurfsparameter in den Entwurfsprozess übertragen. Die Übertragung bildet den Abschluss des hier vorgestellten kulturbasierten Entwerfens im Rahmen der entwurfsbasierten Forschung.