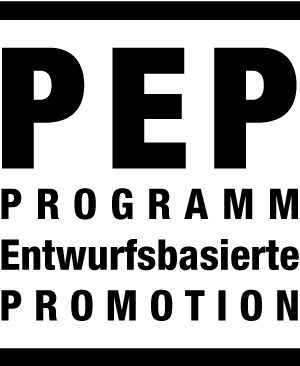Entwerfen zwischen Autonomie und Vermittlung
Ein strategisches Handlungsmodell für den landschaftsarchitektonischen Entwurfsprozess
Landschaftsarchitektur entwirft Freianlagen. Davon ausgehend, dass die Qualität von Landschaftsarchitektur aus ihrer Kontextualisierung entspringt, hat die Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen einer gegebenen Aufgabenstellung grundlegende Bedeutung.
Entwerfen als Landschaftsarchitektur wäre so gesehen jene Handlungskompetenz, bei der Entwerfende bestehendes Fachwissen anwenden, dieses mit lokalem Wissen (Aufgabe, Ort, Menschen) anreichern und in der Überlagerung auf eine angemessen gute Lösung hin projizieren.
Liegt jedoch die gestaltbestimmende Macht von Autoren-Entwerfenden bei den autonom agierenden Handelnden, so machen aktuelle Mitspracheansprüche der BürgerInnengesellschaft eine Neubewertung des Entwurfsprozesses erforderlich.
Wie kann also - dieser Frage geht diese Arbeit im Kern nach - Mitsprache aktiv in den Entwurfsprozess eingebaut werden? Und wie kann gleichzeitig die entwurfliche Autonomie beibehalten werden?
Die vorliegende Arbeit beschreibt ein in der eigenen Praxis entwickeltes Handlungsmodell für das landschaftsarchitektonische Entwerfen. Dessen Besonderheit liegt in der methodischen Verknüpfung von Entwerfen als schöpferische Kulturtechnik mit den kommunikativen Aspekten von Dialog und Vermittlung. Dabei wurde das Handlungsmodell zu Beginn dieser Arbeit als Ausgangsthese formuliert und im Weiteren in der eigenen Praxis ebenso wie in der Lehre wiederholt angewandt und präzisiert.
Der Aufbau dieser Arbeit beginnt mit der Ausgangslage, mithin der Genese und Motivation des Autors. Dies als Begründung für die Einführung eines Handlungsmodells als Orientierungshilfe für die eigene entwurfliche Praxis. Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben das entwurfliche Handeln, beginnend mit dem Handlungsrahmen und der detaillierten Darlegung der einzelnen Arbeitsschritte des Handlungsmodells. Am Beispiel des Projektes Priesterseminar Paderborn erfolgt anschließend die Darstellung der konkreten Anwendung des Modells in Verbindung mit dem Arbeitsmittel Präsentation. Der vorletzte Abschnitt verortet das Handlungsmodell im Kontext anderer Positionen im Wissensfeld zwischen Theorie und Praxis. Das abschließende Nachwort erläutert die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse.
Thematisch verortet sich diese Arbeit im Feld der Designforschung und fokussiert auf den Aspekt "Design als Handlung (Entscheidungshandeln)“ Darüber hinaus bilden Erkenntnisse aus den Bereichen Psychologie, Kommunikations- und Entscheidungstheorie relevante Grundlagen und Bezugspunkte.
Der Beitrag dieser Arbeit für die Community of Practice besteht in der detaillierten Darlegung einer spezifischen Vorgehensweise für das landschaftsarchitektonische Entwerfen. Dabei wird ein über viele Jahre entstandenes Handlungswissen offengelegt und für andere Entwerfende ebenso wie Studierende zugänglich gemacht. Darüberhinaus versteht sich diese Arbeit als konkreter Beitrag im Spannungsfeld zwischen Entwurfsautonomie und Beteiligungsansprüchen.
Schlussendlich möchte die Arbeit einen weiteren Beitrag zur Klärung der Spezifik des landschaftsarchitektonischen Entwerfens leisten. In Fortschreibung des unter Mitwirkung des Autors veröffentlichen Buches „Freiräumen – Entwerfen als Landschaftsarchitektur“ (Fokus auf das entwurfliche Handwerkzeug) behandelt die vorliegende Arbeit nun eine (mögliche) Vorgehensweise für das Entwerfen als Landschaftsarchitektur.

Entwerfen zwischen Autonomie und Vermittlung
Ein strategisches Handlungsmodell für den landschaftsarchitektonischen Entwurfsprozess
Landschaftsarchitektur entwirft Freianlagen. Davon ausgehend, dass die Qualität von Landschaftsarchitektur aus ihrer Kontextualisierung entspringt, hat die Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen einer gegebenen Aufgabenstellung grundlegende Bedeutung.
Entwerfen als Landschaftsarchitektur wäre so gesehen jene Handlungskompetenz, bei der Entwerfende bestehendes Fachwissen anwenden, dieses mit lokalem Wissen (Aufgabe, Ort, Menschen) anreichern und in der Überlagerung auf eine angemessen gute Lösung hin projizieren.
Liegt jedoch die gestaltbestimmende Macht von Autoren-Entwerfenden bei den autonom agierenden Handelnden, so machen aktuelle Mitspracheansprüche der BürgerInnengesellschaft eine Neubewertung des Entwurfsprozesses erforderlich.
Wie kann also - dieser Frage geht diese Arbeit im Kern nach - Mitsprache aktiv in den Entwurfsprozess eingebaut werden? Und wie kann gleichzeitig die entwurfliche Autonomie beibehalten werden?
Die vorliegende Arbeit beschreibt ein in der eigenen Praxis entwickeltes Handlungsmodell für das landschaftsarchitektonische Entwerfen. Dessen Besonderheit liegt in der methodischen Verknüpfung von Entwerfen als schöpferische Kulturtechnik mit den kommunikativen Aspekten von Dialog und Vermittlung. Dabei wurde das Handlungsmodell zu Beginn dieser Arbeit als Ausgangsthese formuliert und im Weiteren in der eigenen Praxis ebenso wie in der Lehre wiederholt angewandt und präzisiert.
Der Aufbau dieser Arbeit beginnt mit der Ausgangslage, mithin der Genese und Motivation des Autors. Dies als Begründung für die Einführung eines Handlungsmodells als Orientierungshilfe für die eigene entwurfliche Praxis. Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben das entwurfliche Handeln, beginnend mit dem Handlungsrahmen und der detaillierten Darlegung der einzelnen Arbeitsschritte des Handlungsmodells. Am Beispiel des Projektes Priesterseminar Paderborn erfolgt anschließend die Darstellung der konkreten Anwendung des Modells in Verbindung mit dem Arbeitsmittel Präsentation. Der vorletzte Abschnitt verortet das Handlungsmodell im Kontext anderer Positionen im Wissensfeld zwischen Theorie und Praxis. Das abschließende Nachwort erläutert die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse.
Thematisch verortet sich diese Arbeit im Feld der Designforschung und fokussiert auf den Aspekt "Design als Handlung (Entscheidungshandeln)“ Darüber hinaus bilden Erkenntnisse aus den Bereichen Psychologie, Kommunikations- und Entscheidungstheorie relevante Grundlagen und Bezugspunkte.
Der Beitrag dieser Arbeit für die Community of Practice besteht in der detaillierten Darlegung einer spezifischen Vorgehensweise für das landschaftsarchitektonische Entwerfen. Dabei wird ein über viele Jahre entstandenes Handlungswissen offengelegt und für andere Entwerfende ebenso wie Studierende zugänglich gemacht. Darüberhinaus versteht sich diese Arbeit als konkreter Beitrag im Spannungsfeld zwischen Entwurfsautonomie und Beteiligungsansprüchen.
Schlussendlich möchte die Arbeit einen weiteren Beitrag zur Klärung der Spezifik des landschaftsarchitektonischen Entwerfens leisten. In Fortschreibung des unter Mitwirkung des Autors veröffentlichen Buches „Freiräumen – Entwerfen als Landschaftsarchitektur“ (Fokus auf das entwurfliche Handwerkzeug) behandelt die vorliegende Arbeit nun eine (mögliche) Vorgehensweise für das Entwerfen als Landschaftsarchitektur.