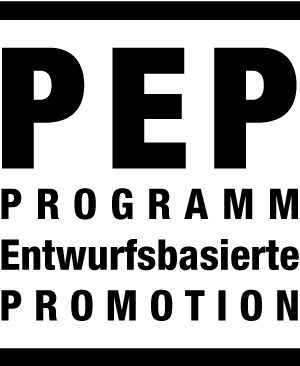Während innerstädtische Industrieruinen in den letzten Jahrzehnten in Mittel- und Westeuropa im Mittelpunkt der architektonischen Forschung und Planung standen, hat sich die institutionelle Kultur Rumäniens bislang nicht an den zeitgenössischen Diskurs angepasst. Bis vor Kurzem wurden vor allem Stätten, die mit dem Glauben, der rumänischen Nation und der historischen und prähistorischen Vergangenheit zu tun hatten, zum Kulturerbe erklärt. Das beim Kulturministerium registrierte Industrie- und Bergbauerbe hatte nichts mit Produktion oder Arbeit zu tun (Wicke, Christian et al., 2018, S. 126).
Die ursprüngliche Absicht der Forschung war es, dem weitverbreiteten Prozess der postkommunistischen kulturellen Amnesie entgegenzuwirken und die besondere Beziehung Rumäniens zu seinen verfallenen Industriestandorten neu zu gestalten. Ziel war es, Handlungsweisen für den Schutz innerstädtischer Brachen zu entwickeln, die es der lokalen Bevölkerung ermöglichen, sich mit ihrem Erbe auseinanderzusetzen, sodass diese Räume, wenn sie erhalten und genutzt werden, von räuberischen Immobilienentwicklungsplänen geschützt werden können. Die postkommunistische Industrieruine wurde durch die Linse der Heterotopie (Foucault, 1970, S.10) betrachtet, um das Verständnis für die komplexen sozialen, politischen und räumlichen Verflechtungen zu fördern, die sie verkörpert, und um einen vielschichtigen methodologischen Ansatz für ihr Potenzial zur Wiederbelebung zu ermöglichen.
Bislang schwankten die etablierten Methoden, die auf rumänischen Industriebrachen angewandt wurden, zwischen invasiven Baupraktiken und einer Fetischisierung, die als Dokumentation durch Film oder Fotografie getarnt wurde. Daraus wurde die Musealisierung (Pușcă, 2010, S.10) als eine zentrale Strategie abgeleitet, die jedoch zeitlich stagniert und durch finanzielle Zwänge außer Kraft gesetzt werden kann.
Das fehlende Bindeglied war ein entwurfsorientierter Ansatz, der zwischen Repräsentation und architektonischer Intervention vermitteln konnte, der eine „Verschiebung des Blicks“ (Ranciere, 2005, S. 13-25) katalysieren würde, indem er Modi der Reflexion sowie Möglichkeiten für weiteres Handeln aufzeigt. In Anlehnung an diese Beobachtungen zielen die nicht-linearen und prozessorientierten Methoden sowie die von dieser Forschung vorgeschlagene emergente Methodik darauf ab, den Transfer von stillschweigendem Wissen zu erleichtern, indem sie es dem Betrachter, dem Leser und der Autorin ermöglichen, die „schmutzigen Konzepte“ (Frichot, 2019, S. 34) der Darstellung, der Analyse und des Entwurfsprozesses zu erleben, anstatt sie zu zwingen, ein Endprodukt zu beobachten, welches relevante, auf dem Weg verworfene Einsichten verdecken könnte und für Veränderungen unempfänglich ist.
Selbst erstellte Design-Fallstudien, die alle in der rumänischen Region Transsilvanien angesiedelt sind, bilden die Grundlage der Arbeit: Ein ausgeführtes Projekt konnte in Echtzeit beobachtet werden, während andere Entwürfe als spekulative Studien dienten und als experimentelle Spielwiesen für verschiedene Designwerkzeuge sowie als allegorische Leinwände für die Darstellung des Bruchs traditioneller Narrative und Ansätze für Industriebrachen genutzt wurden.
Diese Forschung bewegt sich zwischen auto-ethnografischer Studie, atmosphärischer Darstellung und taktischem Design und operiert in den Leerräumen, die Ruinen und wiederverwertbare Gebäude zu einem nicht-binomischen System von Übergangsobjekten verweben (Pilia, 2019, S.71 ). Letztlich veranschaulichen die Ergebnisse der Forschung eine neue Methodik für die Auseinandersetzung mit vernachlässigtem Industrieerbe und präsentieren Entwurfsstrategien für die Annäherung an und die Transformation von gefährdeten Kulturstätten.
While intra-urban industrial ruins have been a focal point of architectural research and planning in Central and Western Europe over the past decades, Romania’s institutional culture has not yet aligned with contemporary discourse. “Until recently, heritage designation was mainly granted to sites pertaining to faith, the Romanian nation, and historic and prehistoric pasts. Industrial and mining heritage registered at the Ministry of Culture listed nothing production or labour-related” (Wicke, Christian et al., 2018, p. 126). This failure to launch and act calls for a novel method of approaching local industrial heritage.
The initial aim of the research was to counteract the widely occurring process of post-communist cultural amnesia and to reframe Romania’s particular relationship with its dilapidated industrial sites. The goal was to develop modes of action for the protection of intra-urban wastelands which could enable the local population’s engagement with their heritage so that these spaces, if maintained and occupied, could be extricated from predatory real estate development schemes. The post-communist industrial ruin was viewed through the lens of heterotopia (Foucault, 1970, p.10) in order to foster an understanding of the complex social, political and spatial entanglements it embodies and to facilitate a multi-layered methodological approach toward its potential for reanimation.
So far, the established methods that have been employed on Romanian derelict industrial sites have oscillated between invasive building practices or fetishisation masked as documentation through film or photography. From this, museumisation (Pușcă, 2010, p.10) was identified as a pivotal strategy, yet the practice is time stagnant and can be overridden by financial imperatives. The missing link lay in a design-oriented approach able to mediate between representation and architectural intervention, which would catalyse a “shift of the gaze” (Ranciere, 2005, p. 13-25) by showing modes of reflection as well as possibilities for further action.
Following these observations, the non-linear and process-oriented methods, as well as the emergent methodology proposed by this research, aim to facilitate the transfer of tacit knowledge by allowing the viewer, reader, as well as the immersed author to experience the “dirty concepts” (Frichot, 2019, p. 34) of representation, analysis, and design process, rather than compelling them to observe a final product which might obscure relevant insights discarded along the way and be impervious to change.
Self-authored design case studies, all located in the Transylvania region of Romania, constitute the base of the doctorate: one executed project could be observed as it functioned in real-time, while the other projects served as speculative design sites and were used as experimental playgrounds for various design tools, as well as allegoric canvases for the representation of the disruption of traditional narratives and approaches to industrial wastelands.
This research situates itself between auto-ethnographic study, atmospheric representation, and tactical design and operates in the voids that weave ruins and salvageable buildings into a non-binomial system of transitional objects (Pilia, 2019, p.71). Ultimately, the doctorate results illustrate a new methodology for engaging with neglected industrial heritage and present design strategies for approaching and transforming endangered cultural sites.

Während innerstädtische Industrieruinen in den letzten Jahrzehnten in Mittel- und Westeuropa im Mittelpunkt der architektonischen Forschung und Planung standen, hat sich die institutionelle Kultur Rumäniens bislang nicht an den zeitgenössischen Diskurs angepasst. Bis vor Kurzem wurden vor allem Stätten, die mit dem Glauben, der rumänischen Nation und der historischen und prähistorischen Vergangenheit zu tun hatten, zum Kulturerbe erklärt. Das beim Kulturministerium registrierte Industrie- und Bergbauerbe hatte nichts mit Produktion oder Arbeit zu tun (Wicke, Christian et al., 2018, S. 126).
Die ursprüngliche Absicht der Forschung war es, dem weitverbreiteten Prozess der postkommunistischen kulturellen Amnesie entgegenzuwirken und die besondere Beziehung Rumäniens zu seinen verfallenen Industriestandorten neu zu gestalten. Ziel war es, Handlungsweisen für den Schutz innerstädtischer Brachen zu entwickeln, die es der lokalen Bevölkerung ermöglichen, sich mit ihrem Erbe auseinanderzusetzen, sodass diese Räume, wenn sie erhalten und genutzt werden, von räuberischen Immobilienentwicklungsplänen geschützt werden können. Die postkommunistische Industrieruine wurde durch die Linse der Heterotopie (Foucault, 1970, S.10) betrachtet, um das Verständnis für die komplexen sozialen, politischen und räumlichen Verflechtungen zu fördern, die sie verkörpert, und um einen vielschichtigen methodologischen Ansatz für ihr Potenzial zur Wiederbelebung zu ermöglichen.
Bislang schwankten die etablierten Methoden, die auf rumänischen Industriebrachen angewandt wurden, zwischen invasiven Baupraktiken und einer Fetischisierung, die als Dokumentation durch Film oder Fotografie getarnt wurde. Daraus wurde die Musealisierung (Pușcă, 2010, S.10) als eine zentrale Strategie abgeleitet, die jedoch zeitlich stagniert und durch finanzielle Zwänge außer Kraft gesetzt werden kann.
Das fehlende Bindeglied war ein entwurfsorientierter Ansatz, der zwischen Repräsentation und architektonischer Intervention vermitteln konnte, der eine „Verschiebung des Blicks“ (Ranciere, 2005, S. 13-25) katalysieren würde, indem er Modi der Reflexion sowie Möglichkeiten für weiteres Handeln aufzeigt. In Anlehnung an diese Beobachtungen zielen die nicht-linearen und prozessorientierten Methoden sowie die von dieser Forschung vorgeschlagene emergente Methodik darauf ab, den Transfer von stillschweigendem Wissen zu erleichtern, indem sie es dem Betrachter, dem Leser und der Autorin ermöglichen, die „schmutzigen Konzepte“ (Frichot, 2019, S. 34) der Darstellung, der Analyse und des Entwurfsprozesses zu erleben, anstatt sie zu zwingen, ein Endprodukt zu beobachten, welches relevante, auf dem Weg verworfene Einsichten verdecken könnte und für Veränderungen unempfänglich ist.
Selbst erstellte Design-Fallstudien, die alle in der rumänischen Region Transsilvanien angesiedelt sind, bilden die Grundlage der Arbeit: Ein ausgeführtes Projekt konnte in Echtzeit beobachtet werden, während andere Entwürfe als spekulative Studien dienten und als experimentelle Spielwiesen für verschiedene Designwerkzeuge sowie als allegorische Leinwände für die Darstellung des Bruchs traditioneller Narrative und Ansätze für Industriebrachen genutzt wurden.
Diese Forschung bewegt sich zwischen auto-ethnografischer Studie, atmosphärischer Darstellung und taktischem Design und operiert in den Leerräumen, die Ruinen und wiederverwertbare Gebäude zu einem nicht-binomischen System von Übergangsobjekten verweben (Pilia, 2019, S.71 ). Letztlich veranschaulichen die Ergebnisse der Forschung eine neue Methodik für die Auseinandersetzung mit vernachlässigtem Industrieerbe und präsentieren Entwurfsstrategien für die Annäherung an und die Transformation von gefährdeten Kulturstätten.
While intra-urban industrial ruins have been a focal point of architectural research and planning in Central and Western Europe over the past decades, Romania’s institutional culture has not yet aligned with contemporary discourse. “Until recently, heritage designation was mainly granted to sites pertaining to faith, the Romanian nation, and historic and prehistoric pasts. Industrial and mining heritage registered at the Ministry of Culture listed nothing production or labour-related” (Wicke, Christian et al., 2018, p. 126). This failure to launch and act calls for a novel method of approaching local industrial heritage.
The initial aim of the research was to counteract the widely occurring process of post-communist cultural amnesia and to reframe Romania’s particular relationship with its dilapidated industrial sites. The goal was to develop modes of action for the protection of intra-urban wastelands which could enable the local population’s engagement with their heritage so that these spaces, if maintained and occupied, could be extricated from predatory real estate development schemes. The post-communist industrial ruin was viewed through the lens of heterotopia (Foucault, 1970, p.10) in order to foster an understanding of the complex social, political and spatial entanglements it embodies and to facilitate a multi-layered methodological approach toward its potential for reanimation.
So far, the established methods that have been employed on Romanian derelict industrial sites have oscillated between invasive building practices or fetishisation masked as documentation through film or photography. From this, museumisation (Pușcă, 2010, p.10) was identified as a pivotal strategy, yet the practice is time stagnant and can be overridden by financial imperatives. The missing link lay in a design-oriented approach able to mediate between representation and architectural intervention, which would catalyse a “shift of the gaze” (Ranciere, 2005, p. 13-25) by showing modes of reflection as well as possibilities for further action.
Following these observations, the non-linear and process-oriented methods, as well as the emergent methodology proposed by this research, aim to facilitate the transfer of tacit knowledge by allowing the viewer, reader, as well as the immersed author to experience the “dirty concepts” (Frichot, 2019, p. 34) of representation, analysis, and design process, rather than compelling them to observe a final product which might obscure relevant insights discarded along the way and be impervious to change.
Self-authored design case studies, all located in the Transylvania region of Romania, constitute the base of the doctorate: one executed project could be observed as it functioned in real-time, while the other projects served as speculative design sites and were used as experimental playgrounds for various design tools, as well as allegoric canvases for the representation of the disruption of traditional narratives and approaches to industrial wastelands.
This research situates itself between auto-ethnographic study, atmospheric representation, and tactical design and operates in the voids that weave ruins and salvageable buildings into a non-binomial system of transitional objects (Pilia, 2019, p.71). Ultimately, the doctorate results illustrate a new methodology for engaging with neglected industrial heritage and present design strategies for approaching and transforming endangered cultural sites.